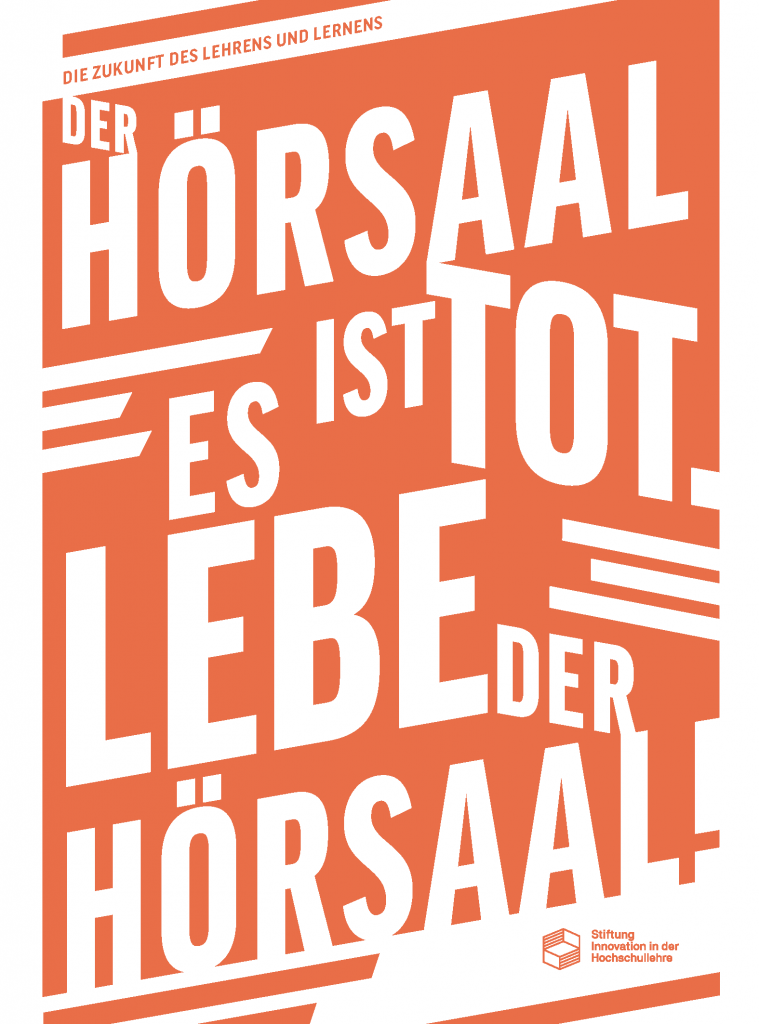Beitrag vom
31.01.2023
Kleine Fächer
Plötzlich im Fokus
Ein Beitrag von Kilian Kirchgeßner
Sobald Alexander Wöll dieser Tage sein Handy kurz zur Seite legt, klingelt es gleich schon wieder. Gerade erst haben Journalist:innen vom Fernsehen angerufen, um den Ukrainistik-Experten zum Krieg zu befragen, jetzt meldet sich jemand von seiner Potsdamer Universität wegen des Ukrainisch-Sprachkurses, der zum ersten Mal angeboten werden soll. „Das Interesse ist gewaltig“, sagt Wöll. Der Sprach- und Kulturwissenschaftler ist Vorsitzender der Deutschen Assoziation der Ukrainisten und ausgewiesener Kenner des Landes: „So einen Ansturm habe ich in all den Jahrzehnten nicht erlebt!“
Und dann kommen Ereignisse wie der russische Überfall auf die Ukraine, die ein kaum bekanntes Fach auf einen Schlag in den Mittelpunkt rücken.
Diese Erfahrung teilen viele Vertreter:innen von kleinen Wissenschaftszweigen. „Orchideenfächer“ werden sie liebevoll genannt, und wer in ihnen forscht, muss außerhalb der engen Fachkreise oftmals um Aufmerksamkeit ringen. Und dann kommen Ereignisse wie der russische Überfall auf die Ukraine, die ein kaum bekanntes Fach auf einen Schlag in den Mittelpunkt rücken. Dass die Forscher:innen Wissen generieren und weitergeben, das in Nischen gefragt und wichtig ist – das ist eine der zentralen Funktionen der sogenannten Kleinen Fächer.
„In Deutschland gibt es derzeit 159 solcher Fächer“, sagt Uwe Schmidt. Er leitet gemeinsam mit Katharina Bahlmann in Mainz die Arbeitsstelle Kleine Fächer, die sich mit deren Bedeutung in der deutschen Forschungslandschaft befasst. Sie stellt überdies die Kriterien auf, die auch ein Kleines Fach zu erfüllen hat: Es muss unter anderem eine Fachzeitschrift und eine Fachgesellschaft geben, es braucht unbefristete Professuren (aber nicht mehr als drei je Standort, sonst wird es zu einem großen oder mittelgroßen Fach – wobei zwei Ausnahmen zugelassen sind) und eigene Studiengänge. „Die meisten der Kleinen Fächer sind an großen Universitäten angesiedelt. Dort ist das Bewusstsein am ausgeprägtesten, wie wichtig die Rolle der Kleinen Fächer ist“, sagt Uwe Schmidt – und einige Hochschulen binden diese gezielt in ihre Exzellenzstrategie ein, weil sie wissen: Das dort versammelte Spezialwissen ist etwas ganz Besonderes.
"Lernen und Lehre sichern. Fokus Ukraine"
Mit der Sonderförderung „Lernen und Lehre sichern. Fokus Ukraine“ schaffte StIL ein Angebot für deutsche Hochschulen, die im Bereich Studium und Lehre auf die Kriegsfolgen für Student:innen und Wissenschaftler:innen aus der Ukraine reagieren möchten.
Orchideenfächer gibt es in allen Fachbereichen. Sprechwissenschaft, Papyrologie oder Vietnamistik sind Beispiele dafür, aber etwa auch Erdöl-Ingenieurwesen, Bioinformatik, Lagerstättenlehre oder Markscheidewesen – bei Letzterem geht es um die untertägige Vermessung von Tunneln und Stollen.
Die Ukrainistik zählt formal allerdings gar nicht als Kleines Fach, denn: „Sie gehört zur Slawistik“, erläutert Uwe Schmidt – darin ist die Expertise zu den slawischen Ländern von Polen über Tschechien bis nach Belarus und eben zur Ukraine gebündelt. Einen eigenen Studiengang zur Ukrainistik gibt es somit in Deutschland nicht – und letztlich: Was genau sollte man darin auch lernen? Das Spektrum des Wissens, das in der Ukrainistik gesammelt und gespeichert wird, deckt eine Breite ab, die gar nicht in ein einziges Studienfach hineinpassen würde. „Es geht um Landes- und Kulturkunde ebenso wie um die Sprache“, erklärt Wöll. Aber auch Fragen zum Wirtschaftssystem und zum juristischen Aufbau des Landes zählen dazu – Wissen also, das eher als Spezialisierung zu anderen Studiengängen passt.
In der Deutschen Assoziation der Ukrainisten sind Expert:innen für alle diese Ausrichtungen versammelt. Rund 40 Mitglieder zählt die Vereinigung. Seit 2008 ist Wöll ihr Vorsitzender. Seit seinem Studium schon bekommt er mit, wie nah Freud und Leid der Orchideenfächer beieinanderliegen. Zuerst sah er nur die Freude, das war zu seinen eigenen Studienzeiten. „Wir waren so eine kleine Gruppe von Enthusiasten – wir hatten immer die tollsten Feiern, die spannendsten Vorträge und die besten Exkursionen“, erinnert er sich: Eine echte Familie sei die Fach-Community gewesen.
Mit 15 Kommiliton:innen war er damals in Russland zu einer Studienreise, es waren die Jahre rund um den Fall des Eisernen Vorhangs. In Lwiw (Lemberg), Odessa, in Czernowitz und der Bukowina war Alexander Wöll schon während seiner Studentenzeit und später für Forschungsprojekte immer wieder – das sind Namen von Städten und Landschaften, die für ihn als Literaturexperten wegen ihrer reichen kulturellen Vergangenheit verheißungsvoll klingen. „Es ist eben ein echtes Studium, so wie man es sich im schönsten Klischee vorstellt: Man taucht richtig ein in seinen Forschungsgegenstand.“
Massenvorlesungen hat er nie kennengelernt – nicht als Student und nicht als Professor.
Massenvorlesungen hat Alexander Wöll nie kennengelernt – nicht als Student und auch heute nicht als Professor. „Einen Teil meines Studiums habe ich in Oxford verbracht, da gab es Tutorials, in denen ich meinen Professor für mich allein hatte. Und das nicht nur, weil die Studienbedingungen dort so großartig sind, sondern weil es eben so wenige andere Kommilitonen gab.“ Auch heute noch, in seinen eigenen Seminaren an der Universität Potsdam, seien die Bedingungen ideal. 15, im Höchstfall auch einmal 25 Studierende sitzen in
seinen Seminaren – „und zwar allesamt Leute, die ich mit Namen kenne!“
Unmittelbar damit hängt aber auch ein leidvoller Aspekt zusammen, den die Lehrenden in allen Orchideenfächern kennen: Es fehlt an Nachwuchs. „Oft haben die jungen Leute die Kleinen, weitgehend unbekannten Fächer einfach nicht auf dem Schirm“, sagt Uwe Schmidt, der Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der StIL ist: „Viele Disziplinen geraten deshalb unter Druck.“ Auf die Lehre wirkt sich das oft positiv aus, denn die Kleinen Fächer machen aus der Not eine Tugend: Die Orchideenfächer sind oft bestens vernetzt; innerhalb der Hochschulen nutzen sie bisweilen die Ressourcen von größeren Disziplinen mit. Und weltweit schließen sie sich zu engen Verbünden zusammen, in denen jeder jeden kennt. Selbst Studierende haben dadurch die Chance, Teil der internationalen
Forscher-Community zu werden und Kontakte zu knüpfen – ein Startvorteil, den es in großen Disziplinen oftmals nicht gibt. Wer sich allerdings eine Karriere in der Wissenschaft wünscht, für den bedeutet das auch Unsicherheit: Wenn es nur wenige Professuren gibt, ist die Chance entsprechend klein, auf eine der sehr selten frei werdenden Stellen berufen zu werden.
Und dann gibt es noch die Fälle, in denen Kleine Fächer ihre Nische verlassen. Die Immunologie zum Beispiel: Sie war in den 1970er-Jahren ein Kleines Fach, das nur an einigen Universitäten in Deutschland gelehrt wurde. Heute gibt es keine Universitätsmedizin mehr, die ohne Immunologie auskommt, weil sie eine immense Bedeutung für die öffentliche Gesundheit hat – das zeigt, wie sich der wissenschaftliche Fortschritt auf die Universitätslandschaft auswirkt. Auch Fächer wie die Ethnologie oder die Gender Studies sind in den vergangenen Jahren zu Disziplinen mittlerer Größe geworden.
Neuerdings muss er in Gesprächen mit Hochschulleitungen und Ministerien nicht mehr begründen, warum seine Disziplin nicht eingestellt werden sollte.
Dass der Ukrainistik eine ähnliche Entwicklung bevorsteht, glaubt der Potsdamer Professor Alexander Wöll nicht. Zumindest aber muss er neuerdings in Gesprächen mit Hochschulleitungen und Ministerien überall in Deutschland nicht immer wieder begründen, warum seine Disziplin wichtig ist und nicht eingestellt werden sollte. Stattdessen laufen bei ihm die Fäden von zahlreichen neuen Initiativen zusammen, die nach dem Überfall auf die Ukraine entstanden sind. Er bringt geflüchtete Kollegen bei sich unter, vermittelt Stellen und Gastdozenturen für Dichter:innen und Wissenschaftler:innen aus der Ukraine und ist jeden Montag beim neu einberufenen Jour fixe der Universitätsleitung dabei – dort werden alle Aktivitäten von Deutschkursen für Flüchtlinge über Vorlesungen zum Ukraine-Krieg bis hin zu Veranstaltungen mit ukrainischen Künstler:innen koordiniert. Er gibt Interviews, bündelt das Know-how seiner Kolleg:innen und beantwortet ständig neue Anfragen aus allen Richtungen. „Mich freut es, dass die Ukrainistik auf einmal nicht nur in den Fachkreisen von Interesse ist, sondern ihren Nutzen für die Gesellschaft eindeutig beweisen kann!“
Dieser Beitrag ist zuerst in unserem Print-Magazin „Der Hörsaal ist tot. Es lebe der Hörsaal!“ erschienen.
Alle weiteren Artikel finden sich im gedruckten Magazin sowie in der Online-Ausgabe des Magazins.